This post is also available in:  English (Englisch)
English (Englisch)
Schon in der Nacht merke ich, dass die Wellen höher sind als am Vortag. Das Schiff schaukelt ein wenig mehr. Es ist nicht unangenehm, sondern eher ein Wiegen. Ich schlafe gut.

Die Maschine muss aber härter gegen den Wind und die Wellen arbeiten, die von vorne kommen.
Beim Frühstück meint der Kapitän, dass die Wellen bis auf den Bugbalkon schlagen werden und rät von einem Besuch der Spitze des Schiffs ab.
Die Bright Sky rollt merklich mehr als in den letzten Tagen. Da der Wind von vorne kommt, ist es eher ein Wippen als ein seitliches Schaukeln.
Ich merke, dass es Donnerstag ist. Ich habe nur noch drei Tage auf hoher See. Sonntag früh werden wir Walvis Bay erreichen.
Immer wieder schaue ich während des Vormittags aus dem Fenster. Die Wellen sind hoch und tragen Schaumkronen.
Ich widme mich meiner Fotos. Da ich sie meistens in RAW schieße, muss ich sie bearbeiten. Das macht mir auch Spaß. Bei den fliegenden Fischen aber gerate ich an meine Grenzen. Ich experimentiere mit meiner Software den ganzen Vormittag herum und habe, glaube ich, endlich ein brauchbares Rezept für die Bildbearbeitung von Fischen gewonnen.
Beim Mittagessen unterhalten sich Pierre und der Kapitän darüber, dass das Schiff bei einem richtigen Sturm regelrecht gewrungen wird. Der Stahl biegt und dreht sich hin und her. Es ist wichtig, dass er sich biegt und dreht, denn dann bricht er nicht. Na ja, so weit sind wir noch lange nicht. Das ist noch nicht mal rauer Wind und schon gar nicht ein Sturm. Ich habe am Morgen sogar noch trotz des schwankenden Schiffs geduscht.
Am Nachmittag schaue ich aufs Meer. Die Wellen sind immer noch hoch und haben Schaumkronen. Ich denke “Sch… darauf! Ich gehe jetzt nach vorne!”
Der Second Officer, der auf der Brücke Dienst hat, schaut bedenklich. Ich könnte nass werden. Wenn ich einen Fotoapparat mitnehmen will, übernimmt er keine Garantie. Ich versichere ihm, dass ich seine Warnung verstanden habe. Er wünscht mir viel Spaß.
Da sowohl der Kapitän als auch der Second Officer mich gewarnt haben, lasse ich den Fotoapparat in der Kabine und laufe zum Bug.
Die Matrosen arbeiten fleißig. Einer schweißt etwas, andere flexen Rost ab oder pinseln neue Farbe, dritte schmieren Stahlseile dick mit Fett ein.
Das Vorderdeck ist nass. Die Wellen schlagen durch das Rohr der Ankerkette hoch und ab und zu kommt Wasser die fünf, sechs Meter bis aufs Deck.
Der Bugbalkon ist trocken. Kein Tropfen Wasser ist hoch gespritzt. Er ist schließlich auch vor dem Bug an sich – ein Balkon halt.
Die großen Wellen schmettern gegen das Vorderdeck. Manchmal spritzt Gischt auf. Das Schiff erbebt durch die Schläge der Wellen.
Es sind erstaunlich viele fliegende Fische unterwegs. Ich hatte gedacht, dass sie bei dem Wind unter Wasser bleiben. Sie fliegen aber wie immer und können genauso weit fliegen wie sonst auch. Selbst die aufgeregten Fischkinder trotzen den kräuselnden Wellen und dem Wind und schaffen ihre ein, zwei Meter.
Die Großen schaffen es sogar, durch die Wellen zu fliegen, vor allem, wenn es spitze Wellen kurz vor dem Brechen sind.
Ich schaue dem Treiben zu und denke über Physik nach. Ich stehe am Ende eines 200 m langen Hebels, der von dem Wind und den Wellen hoch und runter bewegt wird, also genau da, wo die Hebelwirkung am größten ist. Manchmal komme ich dem Meer bis auf drei oder vier Meter nahe, manchmal schwebe ich zwölf oder vierzehn Meter über dem Wasser.
Wenn jetzt jemand beim Lesen seekrank wird, so kann ich ihn beruhigen. Es ist nicht wie ein Fahrgeschäft auf einer Kirmes, das darauf ausgelegt ist, einen bis zum Punkt des Erbrechens zu bringen. Es ist eher wie eine Wippe oder eine Schaukel, die im Zeitlupentempo und sanft hoch und runter geht. Das Schaukeln ist überhaupt nicht furchteinflößend, sondern eher beruhigend. Ich genieße es.
Ich wende mich dann einem anderen Thema der Physik zu: Wellen. Ich beobachte die Wellen und versuche zu ergründen, warum manche mit großem Getöse unter mir auf dem Bug aufschlagen und warum bei anderen das Schiff einfach oben drüberfährt. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Arten Wellen ist vielleicht 1:20. Ist es die Größe der Wellen? Nein, auch bei vielen ganz großen fahren wir einfach drüber. Am Ende komme ich zum Schluss, dass es nicht von der Höhe der Wellen oder der Tiefe der Wellentäler abhängt, sondern vom Abstand zwischen den Wellen. Wenn der Abstand ein bisschen größer ist, spritzt es.
Genug der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es wird kühl auf dem Balkon. Ich stehe da nun schon eine Stunde und überlege, ob ich mich auf den Weg zurück machen sollte. Ich kann mich aber irgendwie nicht losreißen und schaue weiter auf die Wellen und beobachte die fliegenden Fische.
Es gibt auch fliegende Fische mit weißen oder zumindest sehr hellen Flügeln. Es ist vielleicht eine Sache des Alters. Die Kindergarten–Fische haben alle helle Flügel. Zwei oder drei Fische mit blauen Flügeln sehe ich auch. Von denen muss ich unbedingt noch ein Foto machen.
Plötzlich sehe ich Rückenflossen. Delfine! Eine ganze Menge. Sie schwimmen vor dem Schiff hin und her. Ab und zu springen sie aus dem Wasser, um zu atmen. Ich sehe, wie ihr Atmungsloch sich bewegt, wenn sie einatmen, so nahe sind sie. Sie sind braun und haben helle Bäuche.
Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe noch nie Delfine beobachten so nahe beobachten dürfen. Und dann noch so viele!
Sie schließen sich dann in einem Pulk von zehn oder zwölf Tieren zusammen und schwimmen vor dem Schiff her. Direkt unter mir. Ich kann ihre Leiber unter der Wasseroberfläche sehen und zählen. Immer wieder springt ein Tier elegant aus dem Meer, um zu atmen. Dann habe ich das Gefühl, dass ich sie anfassen könnte, so nahe sind sie.
Ich weiß nicht, ob sie sich aus lauter Spaß von der Bugwelle des Schiffes schieben lassen oder ob sie mal schauen wollen, ob sie mit der Bright Sky mithalten können. Manchmal meine ich, dass sich einer unter Wasser umdreht und auf dem Rücken schwimmt, um zu sehen, wie weit der Bug des Schiffes über ihnen liegt. Ich sehe dann nämlich den hellen Bauch des Tieres.
Etwa drei Minuten schwimmen sie so als ganz enge Gruppe in genau dem Tempo des Schiffes. Abwechselnd springen sie zum Atmen aus dem Wasser. Die Gruppe löst sich dann langsam auf. Immer mehr Tiere schwimmen zur Seite und werden von der Bugwelle weggedrückt. Nur drei Delfine halten eisern noch eine Weile das Tempo mit, dann sind auch sie verschwunden.
Boah! Was für ein Erlebnis diesen Tieren so nahe sein zu dürfen! Ich bin sehr glücklich.
Ich stehe noch eine Weile, um zu sehen, ob vielleicht noch einer von der Gruppe auftaucht, aber sie sind weg.
Das muss ich unbedingt sofort Anita erzählen! Ich nehme meine Tasche und gehe zurück zum Schiffsgebäude. Erstmal in den 7. Stock zur Brücke, um mich beim mürrischen Chief Officer zurückzumelden, dann wieder 6 Stockwerke runter zum Büro, wo der allgemeine E–Mail–Computer ist.
Es sind übrigens 15 Treppenstufen pro Etage.
Ich schreibe schnell ein E–Mail an Anita und dann ist es schon Zeit fürs Abendessen. Ich habe da aber was zu erzählen!
Pierre kann sich die Delfine nicht erklären. Die fliegenden Fische sind doch viel zu klein, um ihnen als Futter dienen zu können. Ich könnte jetzt argumentieren, dass es vielleicht noch andere, größere Fische gibt, die sich von fliegenden Fischen ernähren und die wiederum von Delfinen gefressen werden. Diese theoretische mittelgroße Art sehen wir nicht, weil sie weder fliegt, noch aus dem Wasser springt. Ich habe aber keine Lust auf Diskussion. Ich freue mich noch immer viel zu sehr.
Die erste Frage, die der Kapitän stellt, als er von meinem Abenteuer hört, ist, ob ich die Gelegenheit hatte, ein Foto zu machen. Nein. Hatte ich nicht. Alle hatten mir gesagt, dass es da vorne so spritzen würde, dass meine Kamera völlig durchnässt werden würde. Deshalb hatte ich sie nicht mitgenommen. Der Kapitän entschuldigt sich für den falschen Rat, den er und seine Offiziere mir gegeben haben.
Ich bedaure es gar nicht so sehr, kein Foto von den Delfinen zu haben. Ich wäre dann nämlich mit dem Fotografieren beschäftigt gewesen und nicht mit den Tieren.
Nach dem Essen gehe ich nochmal zum Bugbalkon. Diesmal mit Fotoapparat. Es muss doch möglich sein, einen blauflügeligen fliegenden Fisch zu fotografieren.
Der Wind ist nicht mehr so stark, das Meer hat sich beruhigt. Aber es ist zu dunkel, um vernünftige Fotos zu machen. Außerdem sind nur die braun– oder rostflügeligen Artgenossen unterwegs. Ich stehe deshalb nur an der Reling und schaue ins Meer.
Etwa ein Meter unter der Wasseroberfläche schwimmt ein großer Rochen vorbei. Rochen sind die coolsten Fische überhaupt. Langsam mit seinen Flügeln schlagend schwimmt er vorbei und wird dann von der Bugwelle auf die Steuerbordseite des Schiffs geschoben. Es ist kein riesiges Tier, aber eine Spannweite von 1,5 m könnte hinkommen.
Der Fotoapparat liegt zwar in meiner Hand, aber ich bin viel zu fasziniert von dem Tier, um einen Gedanken an die Fotografie zu verschwenden.
Kaum ist der Rochen weg, kommt Pierre durch die Luke geklettert. Ich erzähle ihm vom Rochen. So ein ganz klein wenig habe ich das Gefühl, dass er sich ärgert, das Tier um ein, zwei Minuten verpasst zu haben.
Die Sonne geht unter. Erst denken wir, dass es heute mit einem schönen Sonnenuntergang nichts wird, weil dunkle Wolken im Westen herumhängen. Sie ziehen aber weiter und der Himmel rötet sich vielversprechend. Im Augenblick ist der Bug nicht der beste Ort, um Sonnenuntergänge zu genießen, da wir in Richtung Südosten fahren. Wir gehen zurück zum Schiffsgebäude.
Pierre holt sich ein Bier und einen Plastikgartenstuhl und setzt sich ans äußere Ende vom Außendeck D. Da hat er einen schönen Blick auf die untergehende Sonne.
Ich gehe ein Stockwerk höher, auf den Brückenbalkon auf der Steuerbordseite. Von dort verstellt kein Schiffsaufbau meine Aussicht.

Die Sonne wirft große goldene Flocken auf die Wellen und lässt ein paar Wolken orange und rosa erstrahlen. Es ist einer der spektakulärsten Sonnenuntergänge, die wir bisher hatten, ein würdiges Ende für einen aufregenden Tag.
Wir sind um 19:12 auf S13° 11.102′ E4° 32.920′. Es sind noch 1500 km bis Walvis Bay. Zweieinhalb Tage.
Das nächste Land ist ein Kap im Parque do Iona in Angola, in der Nähe der Mündung des Flusses Curoca – 830 km entfernt.
Während ich diese Fakten in Garmin Basecamp recherchiere, ertappe ich mich dabei, mit dem Cursor der Maus im Kaokoveld herumzufahren. Ganz in der Nähe der Mündung des Curoca in Angola ist die Baia dos Tigres. Da ist der gefürchtete “Doodsakker”, ein Strandabschnitt wo Offroader regelmäßig ihre Autos ans Meer abgeben.
Möchtest du eine Übersicht aller Beiträge zu meiner Reise auf dem Frachtschiff Bright Sky sehen? Hier geht es zu einem Inhaltsverzeichnis.

Anette Seiler
Anette bereist schon seit ihrer Kindheit das südliche Afrika. Sie liebt es, in der freien Natur zu sein, zu campen, Vögel zu beobachten und offroad zu fahren.
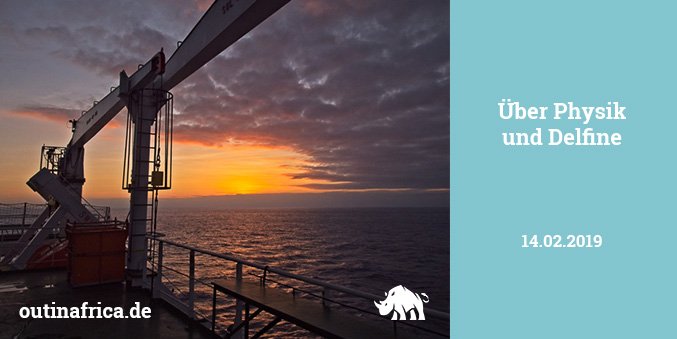


Schreibe einen Kommentar